Selbstbestimmung am Lebensende
 Professor Dr. ingo ProftPrivat
Professor Dr. ingo ProftPrivat
Prof. Dr. Ingo Proft lehrt an der Theologischen Fakultät Trier sowie der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar und leitet das dortige Ethikinstitut. Er hat beim Trierer Hospizabend am 14. Oktober das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 26. Februar 2020 zum § 217 StGB "Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung" erläutert.
Herr Professor Dr. Proft, was genau wurde im Urteil festgelegt und was bedeutet es für die Selbstbestimmung am Lebensende?
Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum bis dato geltenden "Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung in § 217 Abs. 1 StGB" haben sich die Gewichte in der Debatte um die Sterbehilfe deutlich verschoben. Was von Befürwortern als Durchbruch begrüßt wird, der nun eine rechtlich zulässige, ärztlich assistierte Suizidhilfe ermöglicht, wird von Kritikern als Dammbruch, als radikale Wertverschiebung aufgefasst, die den Arzt als Dienstleister eines möglichst schnellen und komplikationslosen Sterbens versteht.
In der Begründung des Urteils wird die Selbstbestimmung in die Nähe der Menschenwürde gerückt (Kombinationsgrundrecht aus Art 2 Abs. 1 GG und aus Art. 1 Abs. 1) und damit aufgewertet. Unklar ist dabei jedoch, was Selbstbestimmung im Konkreten heißt und ob diese immer so eindeutig zu bestimmen ist, wie das Urteil nahelegt. Für Juristen, Ärzte und Pflegekräfte und nicht zuletzt auch für Patienten und ihre Angehörige entpuppt sich die vermeintlich "neue" Rechtssicherheit als Unsicherheitsfaktor - nur mit anderem Vorzeichen.
Warum spricht man hier von einer grundlegenden Veränderung in der Rechtsprechung?
Die Frage nach einer Hilfe zur Selbsttötung wird seit Jahren in Deutschland kontrovers diskutiert. In dieser Auseinandersetzung hat der Deutsche Bundestag Ende 2015 eine wichtige Positionierung vorgenommen: Mit der Einführung des § 217 StGB hatte er damals die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe gestellt.
Gegen diese Regelung wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt, unter anderem mit der Begründung, der Paragraph sei unverhältnismäßig, nicht verfassungskonform und schränke das Recht auf persönliche Selbstbestimmung, im Falle schwerer Krankheit und eines unüberwindbaren Leidens dem eigenen Leben unter Hinzuziehung eines Arztes ein Ende zu bereiten, radikal ein. as Bundesverfassungsgericht hat sich daraufhin mit der Verfassungsbeschwerde beschäftigt und in seinem Grundsatzurteil vom 26. Februar 2020 das sogenannte Sterbehilferecht neu bewertet und dabei die grundrechtliche Position suizidwilliger Personen deutlich gestärkt.
Welche Herausforderungen bringt die neue Rechtsprechung für Ärzte, Ärztinnen und Pflegende in Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen und zu Hause?
Das Bundesverfassungsgericht spielt durch die neue Rechtsprechung den Ball an den Gesetzgeber und damit nicht zuletzt auch an die Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen zurück. Es beauftragt den Gesetzgeber, konkrete Regelungen zu entwickeln ( hier ist die Rede von einer hohen Kontrolldichte), die verhindern sollen, dass kranke und sterbende Menschen dem Zwang zur Rechtfertigung ihres Daseins ausgesetzt werden.
Viele Fragen bleiben dabei jedoch offen, manche Ausführungen in der Begründung des Urteils wie auch in den damit verbundenen Konsequenzen für den Gesetzgeber, für Landesärztekammern, für Träger von Gesundheit und Sozialeinrichtungen sind hoch umstritten oder zumindest kontrovers diskutiert. Dies betrifft insbesondere die rechtliche Ausgestaltung seitens des Gesetzgebers wie daran anschließend deren Umsetzung in die Praxis. Damit verbindet sich natürlich auch die Frage, ob und in welcher Form konfessionelle Trägerschaften zukünftig (noch) eine Sonderrolle einnehmen können.
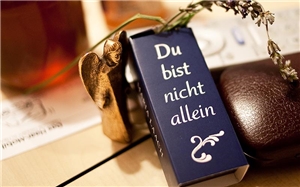 Die Gewissheit, nicht allein zu sein, spendet Trost.DCV/Anne Schönharting
Die Gewissheit, nicht allein zu sein, spendet Trost.DCV/Anne Schönharting
Welche Konsequenzen aus dem Recht auf einem selbstbestimmten Tod wird es für kirchliche Einrichtungen geben?
Mit Blick auf eine christliche Kultur des Sterbens wird schnell deutlich, dass ein Autonomieverständnis, das Selbstbestimmung am Lebensende (nur) auf einen rechtlichen Anspruch zur medizinisch assistierten Lebensbeendigung verkürzt, an der Lebenswirklichkeit und an einem echten Bedürfnis nach Begleitung und Hilfe im Sterben vorbeigeht. Stattdessen bedarf es eines Perspektivwechsels, der neben einer guten medizinisch-pflegerischen, besonders auch palliativen Versorgung, wieder stärker die Beziehung - gerade auch mit Blick auf professionelle Kräfte - in den Vordergrund rückt. Wenn auch Krankenhäuser, Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Hospize gemäß ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen, ganz eigener Konzepte bedürfen, so verbindet sie doch eine gemeinsame Perspektive, die Sterben nicht als sinnentleert, sondern vielmehr als integralen Bestandteil des Lebens versteht und dies auch im Umgang mit Krankheit, Leid und Schmerz erfahrbar werden lässt.
Christlich gesprochen meint Nächstenliebe nicht nur eine Leidensminderung nach allen Möglichkeiten ärztlicher/pflegerischer Kunst, sondern auch eine mitmenschliche Nähe, die gerade auch um die Grenzen des Menschen weiß und damit verantwortlich umgeht.
- Ein Audio-Mitschnitt des Vortrags steht auf dem Youtube-Kanal des Ethik-Instituts Vallendar/Trier bereit www.youtube.com oder www.pthv.de.


